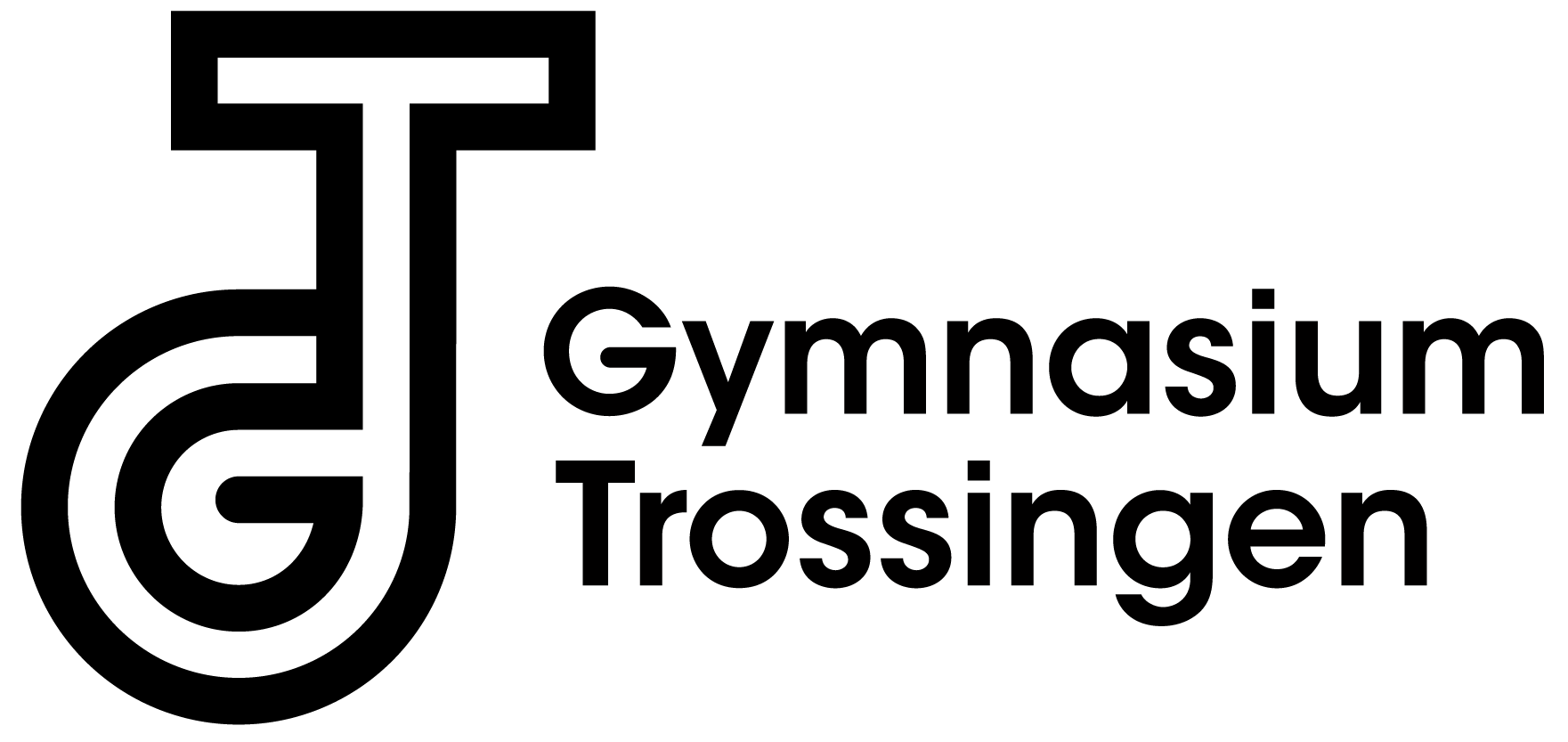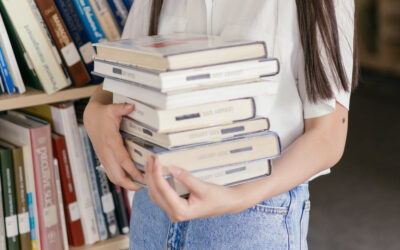80 Schülerinnen und Schüler stellten sich im Rahmen der Gedenkstättenfahrt zum Konzentrationslager Natzweiler-Struthof dieser Herausforderung. Stück für Stück wurden die Anlage begangen, die Barracken begutachtet, die Gaskammer und Galgen betrachtet, Todesgraben, Krematorium und Aschegrube begriffen. Konsterniert wurden die Räumlichkeiten durchschritten und mit beklommener Neugier nachgehakt – über das unvorstellbare Grauen, das an diesem Ort stattfand, und die Menschen, die dieses Grauen mit gnadenloser Präzision planten, logistisch durchführten und am Ende vor Gerichten zu rechtfertigen versuchten. Was war und bleibt mag unbegreiflich erscheinen, doch konnten sich die Schülerinnen und Schüler dieser Unbegreiflichkeit ein Stück nähern.
Am nächsten Tag fand die Nachbereitung statt. In Form dreier Module wurden Impressionen vom Vortag gesammelt, besprochen und mit zusätzlichem Wissen vertieft. In der Frage nach der Notwendigkeit der jährlichen Gedenkstättenfahrt prallten differenzierte Perspektiven aufeinander. Zwischen dem Ruf nach Erinnerungsverantwortung und der Sorge um emotionale Überforderung entspann sich ein Diskurs, der den Wert historischer Konfrontation ebenso auslotete wie die Grenzen pädagogischer Zumutbarkeit. Doch bestand eine selbstverständliche Einigkeit unter den Schülerinnen und Schülern; ein Besuch sei unabdingbar, um die im Unterricht vermittelten Gräuel einzuordnen und zu erleben.
Der britische Dokumentarfilm Night Will Fall ergänzte erschütternd die Inhalte der Fahrt mit filmischem Material aus der Befreiung der Konzentrationslager Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau und Majdanek. Die Zeugnisse aus Arbeits- und Vernichtungslagern machten das Unfassbare noch einmal sicht- und speicherbar. Der Film ließ die Gräuelbilder in einer Drastik sprechen, die Worte allein kaum fassen können und stellte eindringlich die Frage, was Menschen sehen müssen, um nicht mehr wegzuschauen oder gar die Unmenschlichkeit des NS-Regimes zu leugnen.
Im dritten Modul setzen die Schülerinnen und Schüler sich mit vertieften Inhalten zur Vorzeit des NS, der mühsamen Aufarbeitung und der Parallelität zwischen der heutigen und damaligen Zeit auseinander. Was als ferne Geschichte begonnen hatte, zeigte plötzlich seine Schatten inmitten der Gegenwart. In angespannter Stille wurde diskutiert: über die Fragilität der Demokratie, über Sprachbilder, die stigmatisieren, über politische Bewegungen, die aus der Mitte nach rechts drängen und über die Verantwortung, die daraus erwächst.
Am Ende blieb das Unbegreifliche unbegreiflich – greifbarer und unmittelbarer als zuvor, jedoch nicht verständlicher. Doch wandelte sich die Grundfrage, von der Frage des Begreifens zu der Frage des Verhinderns.